Der deutsche Medienwissenschafter Bernhard Pörksen über sein erhellendes Buch „Zuhören“, die Mechanismen der Propaganda, Wiener Aktionsmus, Elon Musks Plattform X und wie sich Magazine und Tageszeitung neben Bloggern behaupten können.
von
Schon 1999 hatte ein junger Journalist schwere Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule, einem Erziehungshem in Hessen, aufgedeckt. Es sollte zehn Jahre dauern, bis die Verbrechen ins Zentrum öffentlichen Interesses rückten. Anlass für den deutschen Medienwissenschafter Bernhard Pörksen, zu ergründen, warum die Opfer nicht eher gehört wurden. In seinem 330 Seiten starken Band „Zuhören“ spannt er den Bogen seiner Recherchen bis zu den Mechanismen russischer Propaganda im Ukrainekrieg. Ein Gespräch über richtiges Zuhören, den Einfluss von Populisten und die Chancen, dass Zeitungen und Magazine heute gehört werden.
Herr Pörksen, wie ist der Titel Ihres Buches, „Zuhören“ zu verstehen? Als Aufforderung oder als Warnung?
Eher als ein kleiner Stupser, als Kopfnuss für Selbstdenker, nicht als langweilig-berechenbare Tugend-Predigt, die ohnehin alles erkalten lässt und kaputt macht.
Sie sagen: Wir hören viel zu oft nur uns selbst …
… geleitet von einem Ich-Ohr egozentrischer Aufmerksamkeit. Hier geht es um die Frage: Stimmt das, was der andere mir sagt, mit dem überein, was ich ohnehin glaube? Die eigenen Filter sind hier äußerst mächtig. Aber wie geht, so meine Frage, eigentlich geistige Offenheit? Wie gelangt man vom Ich-Ohr zum Du-Ohr nicht-egozentrischer Aufmerksamkeit, orientiert an der Frage: In welcher Welt ist das, was der andere sagt, plausibel, wahr? Sie zeigen mit dem Beispiel von Søren Kierkegaards Clown, der den Ausbruch eines Feuers melden will, dass es auf richtiges Zuhören ankommt.
Wie kann man das erreichen?
Das ist eine wirklich tiefsinnige Geschichte des dänischen Philosophen, oder? Da ist dieses Zirkuszelt, das Feuer fängt. Und der Clown wird ins Dorf geschickt, schon geschminkt, verkleidet, mit seinen seltsamen Latschen. Er bettelt, er bittet die Dorfbewohner, doch zum Zirkuszelt zu eilen. Weil sonst das Feuer alle vernichten wird.
Aber die Dorfbewohner halten alles für eine Werbetrick.
So ist es. Und plötzlich ist dann das Feuer überall. Die Botschaft: Manchmal muss man auch dem Clown Glauben schenken. Und das eigene Sofort-Bescheidwissertum – Clowns machen nur Witze! – abstreifen. Um wirklich zuzuhören. Und zu erkennen, was droht.
Sie schildern, wie ein Ukrainer seinen Vater davon überzeugen will, nicht auf die Fake News russischer Propaganda zu hören. Welche Chancen gibt es, gegen Propaganda aufzutreten?
Das ist schwer. Der Desinformationsnebel ist mächtig. Und letztlich scheitert Misha Katsurin, der Unternehmer aus Kiew, dessen Vater in Russland lebt und der seinem Sohn nicht glaubt, dass wirklich Krieg ist. Katsurin will erreichen, dass zu Kriegsbeginn Millionen von Ukrainer ihre Verwandten in Russland anrufen, ihnen von der Wahrheit des Krieges erzählen, zum Protest aufrufen. Er will eine Graswurzel-Bewegung auslösen – um das Miteinander-Reden und Einander-Zuhören zu stärken. Letztlich misslingt dies, trotz mancher Erfolge. Aber eben auf eine lehrreiche, berührende Weise, geht es doch um die Frage: Wie erreicht man diejenigen, die man nicht mehr erreicht? Wie spricht man, wenn der Ausnahmezustand herrscht, wenn Gewalt, Hass und Desinformation alles vergiften? Wo sind sie dann, die Lücken für die geistige Offenheit? Misha Katsurin entwirft hier faszinierende Anleitungen. Aber Sie haben recht: Letztlich kommen er und sein Team gegen den Krieg nicht an.
Weil heute jeder zum Sender geworden ist, kann man die Reputation eines Menschen in Rekordzeit zerstören
Wären rechte Parteien wie die AfD oder die FPÖ so erfolgreich, wenn es ein genaues Zuhören gäbe?
Das ist eine unglaublich aufschlussreiche gedankliche Spur. Denn das Interessante ist doch: Populisten sind Zuhör-Simulanten, die für sich in Anspruch nehmen, die „wahre“ Stimme des Volkes zu hören. Und dann auch noch gemäß dieser zu handeln. Faktisch errichten sie mit ihren extremistischen Attacken, ihrem Hass auf Andersdenkende und Anderslebende, Zuhör-Blockaden in Serie, erschaffen Feindbilder. Das heißt: Zuhören in einem tiefen, genauen Sinne – eben verursacht durch das populistische Polarisierungsspektakel – wird schwieriger. Und gleichzeitig wichtiger.
Sie schreiben, dass es keine „Fertigrezepte für Zuhör-Entscheidungen“ gibt. Wie lässt sich richtiges Zuhören erreichen?
Sehen Sie, ich will eines unbedingt mit diesem Buch: Raus aus der Ratgeber-, der Kuschel- und Psycho-Ecke! Und im Ringen um eine andere Ernsthaftigkeit der Kommunikationsanalyse eben doch eines sagen: Zuhören ist die Basis von allem – ohne das Zuhören keine Debatte, kein sinnvoller Streit, keine Versöhnung, keine gut begründete Verurteilung …
Aber was hat es mit dem richtigen Zuhören auf sich?
Es geht um eine Art Wahrnehmungsschule, um eine Kunst des Herausfindens, passend zur eigenen Person, zur beruflichen Rolle, zur gesellschaftlichen Situation. Und das heißt: Es gibt keine Zuhör-Regeln für alle Fälle. Kommunikative Wahrheit ist immer konkret. Aber was man dann doch sagen kann: Es gilt, die reflexartige Verurteilung des Anderen erst einmal auszusetzen, sich mit ihm in der Tiefe zu befassen, abseits der Klischees, sensibel für Situationen und Kontexte. Dann gelingt das Du-Ohr-Zuhören – vielleicht.
Sie schildern, wie der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen an der deutschen Odenwaldschule erst zehn Jahre nach dessen Aufdeckung ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist. Was lernen wir davon?
Wir lernen, dass es eine Ur-Ursache für jeden Skandal gibt, nämlich: fehlendes Zuhören im System. Die missbrauchten Jugendlichen sangen Spottgesänge über einen der Haupttäter, den Schulleiter. Sie bauten vor seinem Haus auf dem Schulgelände in einer Nacht einen riesigen Holz-Phallus auf. Es gab Witze im Lehrerkreis über die pädokriminellen Neigungen dieses Mannes. Das heißt: Wir sind hier mit dem Rätsel wissender Ignoranz konfrontiert. Eigentlich müsste man nur hinhören, hinschauen, aber das geschieht über Jahrzehnte hinweg nicht. Weil die Anhänger in ihrer Bewunderung für die angeblichen Meisterpädagogen alles vernebeln und vertuschen.
Menschen sind Profis der Ignoranz, lernt man aus Ihrem Buch.
Ja. Ignoranz ist eine Art Supermacht, die Kommunikation untergründig regiert. Die Konsequenz: Man muss das unmöglich Scheinende für möglich halten. Reform-Pädagogik-Gurus und kirchliche Priester sind nicht notwendig Heilige. Und völlig zu Unrecht bewunderte Aktionskünstler wie Otto Muehl können sich als schlimme Missbrauchstäter entpuppen, die gesellschaftliche Ächtung verdienen. Nur mal nebenbei: Das Wiener Aktionismus Museum feiert das Werk dieses Pädokriminellen auf geradezu groteske Weise. Die einstigen Kinder der Kommune, manche von ihnen wurden schwer missbraucht, sind hier nahezu unsichtbar; die Taten werden weggenuschelt. Auch dies ein Beispiel wissender Ignoranz. Und fehlenden Zuhörens mitten in Wien.


Bernhard Pörksen
wurde 1969 in Freiburg im Breisgau, Deutschland, geboren. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Bekannt wurde er durch seine Arbeiten zur Skandalforschung, seine Analysen zu den gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung (Die große Gereiztheit) sowie seine Bücher mit dem Kybernetiker Heinz von Foerster (Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners) und dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun (Kommunikation als Lebenskunst und Die Kunst des Miteinander-Redens). Für seine Lehr- und Publikationstätigkeit erhielt er verschiedene Auszeichnungen (u. a. die Wahl zum Professor des Jahres, Erich Fromm-Preis und gemeinsam mit Friedemann Schulz von Thun den Preis „Gegen Vergessen – für Demokratie“).
Wollen Sie damit sagen, dass man Otto Muehl nicht mehr ausstellen soll?
Ich bin der Auffassung, dass der jetzige Umgang mit Otto Muehl und den von Missbrauch betroffenen Kommune-Kindern in diesem Museum ein Skandal ist, unangemessen, undurchdacht und falsch. Die Hinweise auf Otto Muehls Taten erinnern an die Verspätungsdurchsagen der Bahn – lieblos, empathiefrei gegenüber den Betroffenen, im Kern ignorant. Natürlich, ich kenne das ganze Gerede einer heimlich faszinierten Kulturschickeria … wir müssen das Werk vom Künstler trennen … bla …bla …bla …
Soll man Mühl also canceln?
Nein. Meine ganze Kommunikationstheorie kann ich auf einen einzigen Satz zusammenschnurren lassen. Dieser lautet: „Der Kontext ist die Botschaft“. Ich sage: Mühls Verachtung von Frauen und Kindern ist der Kontext seiner Kunst. Nötig sind also die Videomitschnitte seiner unerträglichen Gewaltausbrüche, die Berichte über die Vergewaltigung von Minderjährigen; nötig ist das ganze, hässliche Bild eines Mannes, für den Kunst und Leben eins waren. Ich kann von einem Erlebnis im Museum erzählen. Ich habe nach dem Besuch der Ausstellung in Wien gegenüber der sehr netten Frau an der Kasse einen veritablen Wutausbruch hingelegt. Danach kamen wir ins Gespräch. Ich sagte: Kennen Sie eigentlich den Film von Paul-Julien Robert „Meine keine Familie“, der in der Kommune aufwuchs und schildert, wie es den Kindern da ging? Sie sagte, dass sie weiß, dass es diesen Film gibt. Aber sich ihn bewusst nicht anschaut. Denn dann müsste sie womöglich ihren Museums-Job aufgeben. Das ist es. Wissende Ignoranz. Weghören, um sich zu stabilisieren. Ich will das nicht verurteilen. Und doch: Unter solchen Bedingungen kann alles passieren.
Stimmt es, dass durch die #Metoo-Bewegung eine neue Art des Zuhörens entstanden ist?
Dem ist so, ja. Hier entstehen, ermöglicht durch die digitalen Medien, Gemeinschaften und Protestbewegungen neuen Typs. Ich nenne sie „Konnektive“ – Ich-Wir-Gemeinschaften, Organisationen ohne feste Organisation. Gedemütigte, angegriffene, missbrauchte Frauen erzählen ihre Geschichte, sind in ihrer Individualität doch gleichzeitig Teil einer Bewegung, einer Welle, die öffentlich das Thema setzt. Das ist eine der wirklich großartigen Möglichkeiten der Vernetzung. Sie hat, trotz mancher Rückschläge, viel erreicht.
Das Nicht-Zuhören machte viele Vergehen möglich. Heute kann man sehr leicht jemanden verklagen. Aber haben es die Beschuldigten nicht schwerer, sich Gehör zu verschaffen?
Ich tue mir schwer mit einer grundsätzlichen Antwort, zumal als bekennender Verteidiger des Konkreten. Aber Sie haben recht: Weil heute jeder zum Sender geworden ist, kann man auch bloße Behauptungen, Gerüchte, dummes Geraune publizieren. Und mitunter die Reputation eines Menschen in Rekordzeit zerstören. Diese Erfahrung des Kontrollverlusts kann etwas Alptraumhaftes bekommen. Gleichzeitig können Menschen mit genug Geld aggressive Anwälte in Stellung bringen. Und im Extremfall durch Einschüchterung überdecken, dass sie tatsächlich Dreck am Stecken haben.
X ist jetzt eine Jauchegrube, voller Hass und Hetze. Elon Musk ist die Symbolfigur des digitalen Feudalismus
Ersetzen Influencer, Blogger heute tatsächlich klassische Nachrichtensendungen und Zeitungen?
Unter keinen Umständen, nein, auch wenn sie faktisch einflussreicher werden. Aber den Influencern fehlt in der Regel das publizistische Ethos; das ist oft einfach Marketing, oft einfach Werbung, man will ein Produkt verkaufen, einen Lifestyle bewerben oder eine politische Weltanschauung durchsetzen. Journalismus ist hingegen – idealerweise – unabhängige, ausreichend kratzbürstige, faktenorientierte Gesellschaftsbeobachtung. Diese ist unverzichtbar, auch wenn die Zeiten härter werden.
Welche Chancen haben Magazine und Tageszeitungen, auch im Internet, heute beachtet zu werden?
Die Chancen sind da, aber es wird schwieriger, im großen Rauschen durchzudringen – gleich aus drei Gründen. Zum einen brechen die Anzeigeneinnahmen weg. Es fehlen also – jenseits der zahlenden Nutzer bzw. Abonnenten – wichtige Finanzquellen. Zum anderen haben mächtige Plattformunternehmer die Herrschaft über die Vertriebskanäle erobert, sie zwingen mit ihren auf Krawall und Überhitzung trainierten Algorithmen zur Anpassung. Und schließlich werden die Journalismusverächter mächtiger. Populisten aller Länder arbeiten hart daran, publizistische Unabhängigkeit zu attackieren.
Soll man auf Musks Plattform X bleiben oder diese verlassen?
Verlassen. Musk hat X längst diesen besonderen Geschmack, diesen besonderen Vibe genommen, den die Debatten auf Twitter einst besaßen. Das Ganze ist jetzt eine Jauchegrube, voller Hass und Hetze. Und Elon Musk ist längst die Symbolfigur des digitalen Feudalismus und einer Neudefinition von Macht, in der sich sehr viel Geld mit sehr viel politischem Einfluss und der Herrschaft über die mediale Infrastruktur verbinden. Da muss man dagegenhalten, trotz der Hilflosigkeit und möglichen Bedeutungslosigkeit eines solchen Bekenntnisses. Man sieht hier: Eigentlich bräuchte es eine Institution anderer Art, wie der Netztheoretiker Michael Seemann einmal vorgeschlagen hat: mächtige transnationale Nutzergewerkschaften, die Druck aufbauen können. Der Einzelne ist weitgehend machtlos, leider.
In Ihrem Buch zeigen Sie auf, wie Vorurteile die Wahrnehmung beeinflussen. Was empfinden Sie, wenn Sie damit konfrontiert werden?
Für mich ist das nicht wirklich ein Schock, sondern geistig-kognitive Normalität. Wir Menschen sind bestätigungssüchtige Wesen, das ist eine Tatsache. Und wir sind in eine Medienwelt hineingestürzt, die lauter wird, immer lauter. Hier – ohne Pessimismus und ohne Zukunftsangst, im Vertrauen auf Aufklärung und Mündigkeit – ein paar Ideen in die öffentliche Debatte einzuschleusen, das ist alles, was ich will.
Mehr nicht?
Nein, dann würde man schon wieder lospredigen, Zuhör-Gebote formulieren. Diese Zeit ist vorbei. Und das ist gut so. Für mich sind Bücher Flaschen-Post-Publizistik. Man wirft sie ins Meer. Mal sehen, was daraus wird.
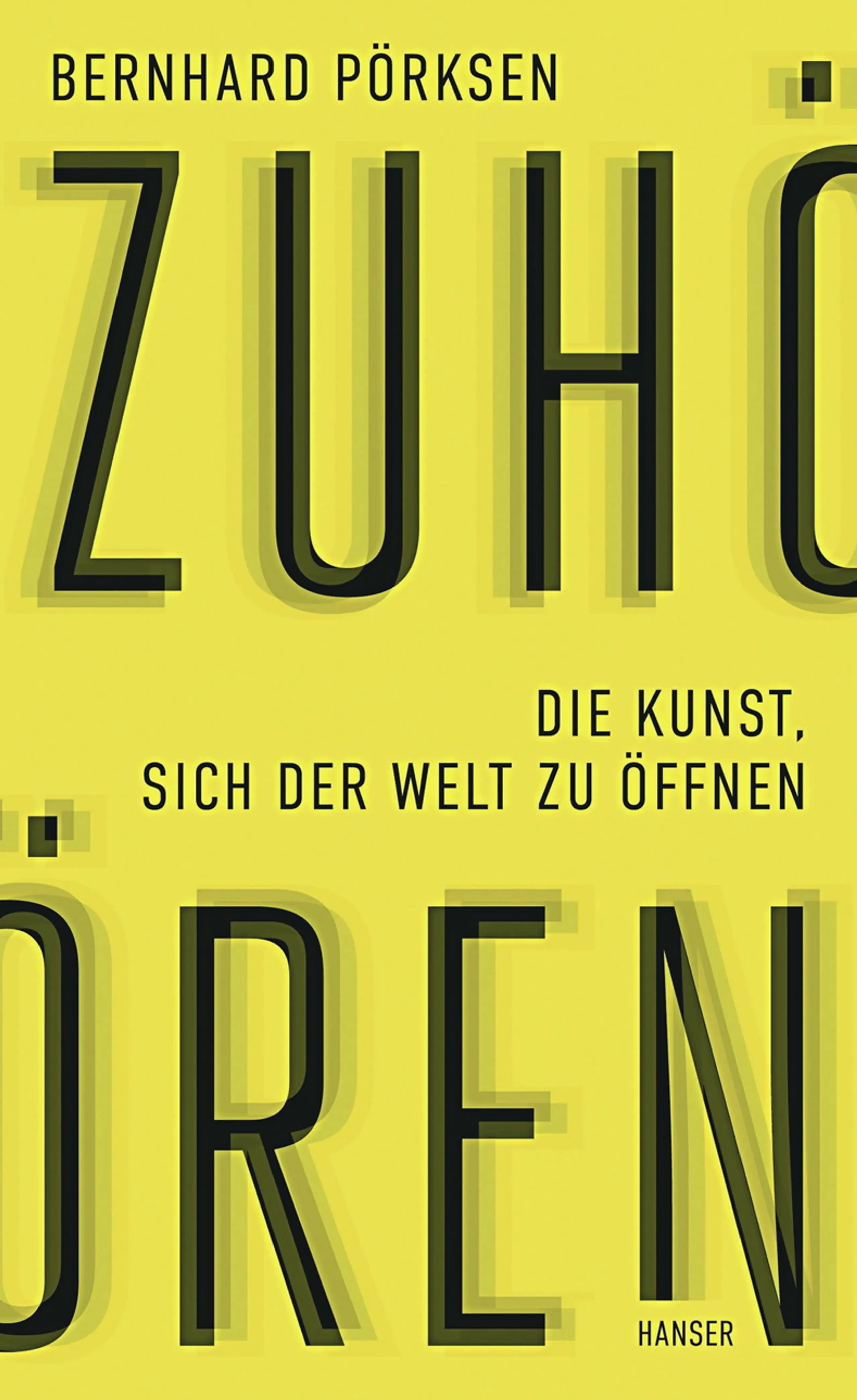
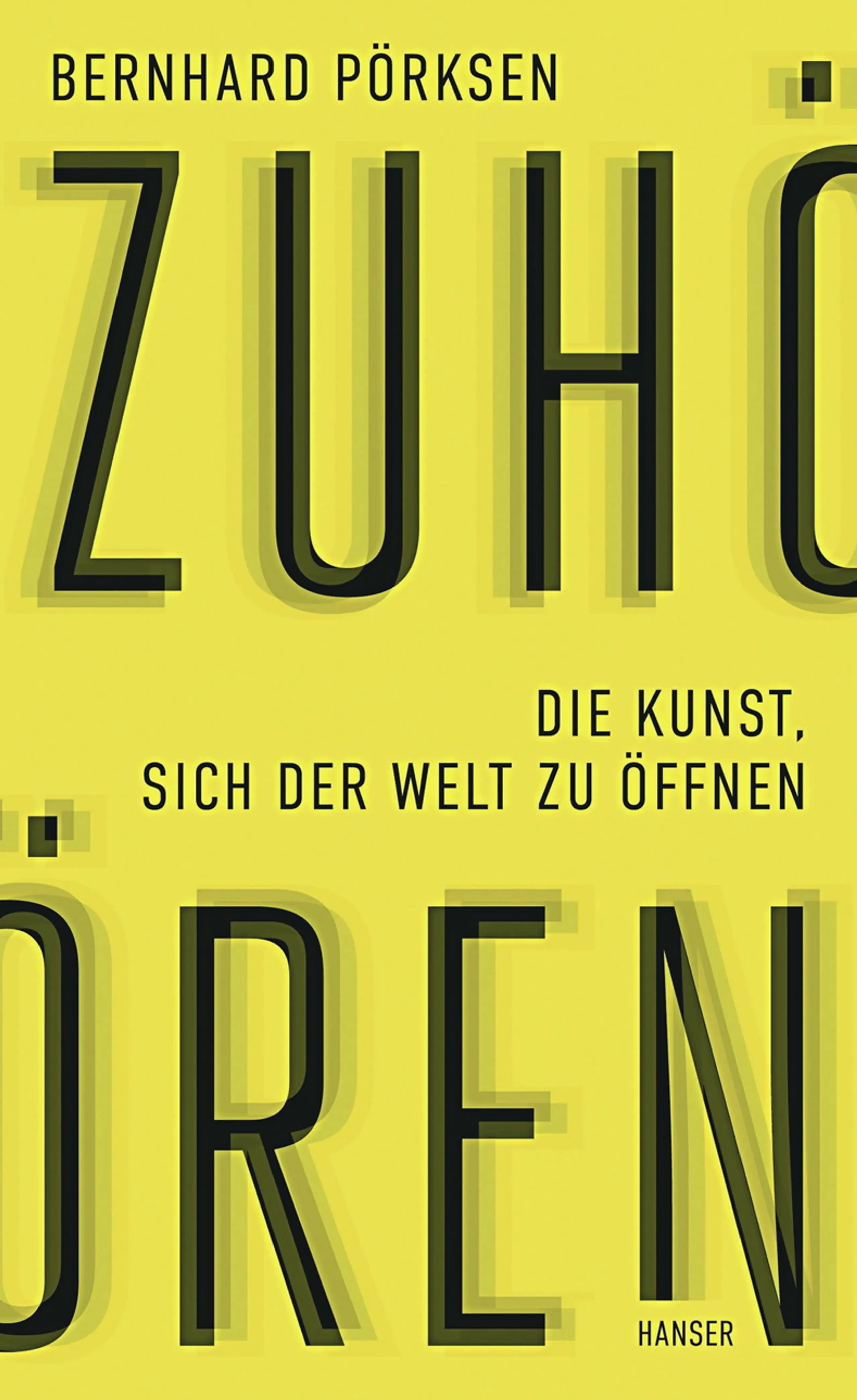
Das Buch
Erhellend, informativ, lehrreich – „Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen“ von Bernhard Pörksen
Hanser, € 25,70
© HanserDieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr.07/2025 erschienen.

