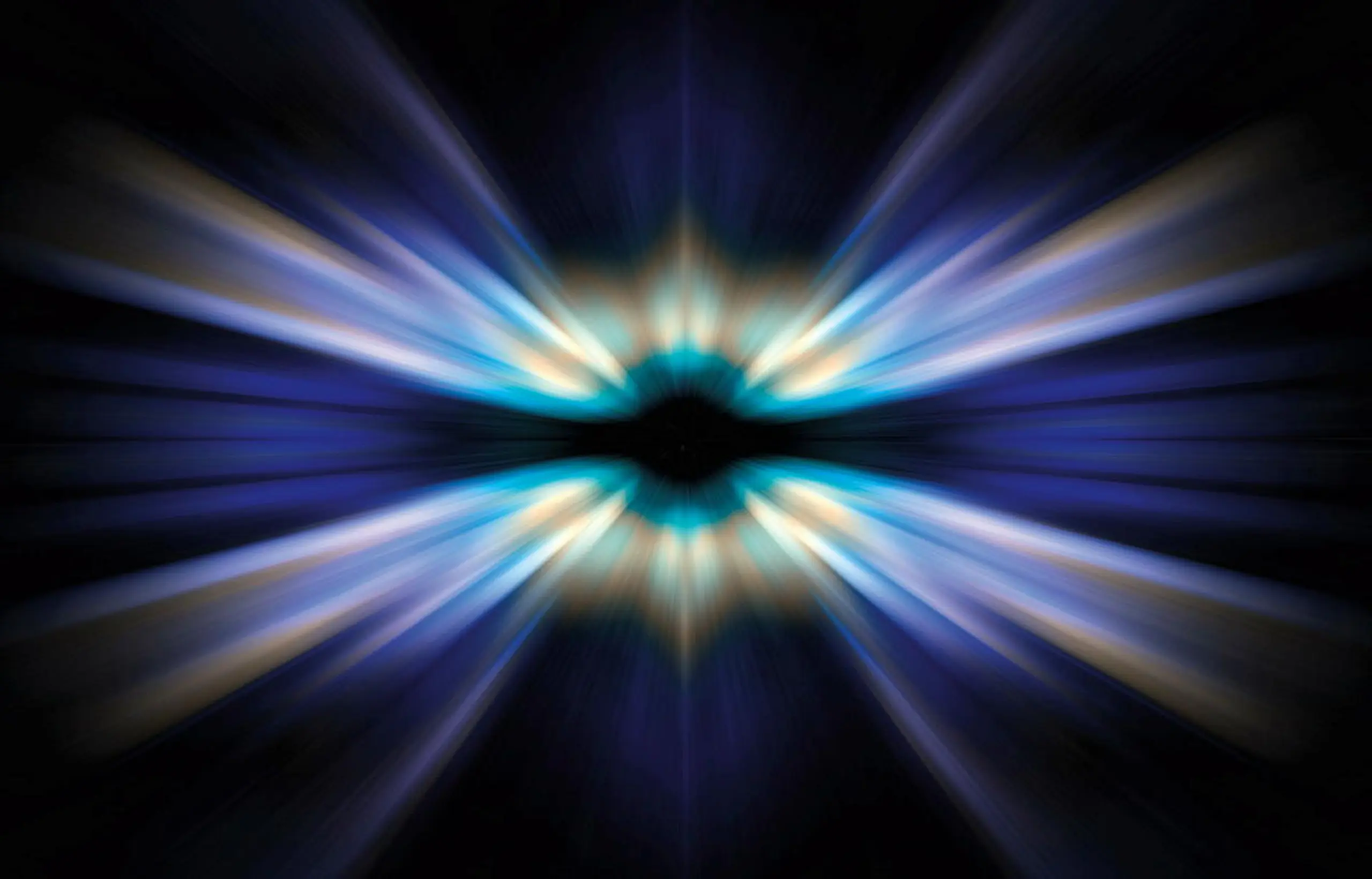"Mit 18 hatte ich das Pfeiffersche Drüsenfieber. Seither hab ich mich nie wieder so gefühlt wie davor", blickt die heute 27-jährige Rea zurück. "Ich war kraftlos und ständig krank, hatte eine Erkältung nach der anderen." Es sollte Jahre dauern, bis sie den Grund dafür erfuhr: Rea leidet am chronischen Erschöpfungssyndrom.
von
Das chronische Erschöpfungssyndrom, auch Chronic Fatigue Syndrome (CFS) oder ME/CFS genannt - ME steht für Myalgische Enzephalomyelitis -, ist eine schwere Multisystemerkrankung. Bemerkbar macht sie sich durch eine allumfassende körperliche und geistige Erschöpfung, die sich durch Ruhe nicht verbessern lässt. "Oft kommt es schon nach banalen Tätigkeiten wie Stiegensteigen oder Wohnungputzen zu einer massiven Verschlechterung des Allgemeinzustands", erklärt der auf ME/CFS spezialisierte Wiener Neurologe Dr. Michael Stingl. "Nicht wenige müssen den Großteil ihrer Zeit im Bett liegend verbringen."
Der Auslöser ist in den meisten Fällen ein viraler Infekt
Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Man geht davon aus, dass ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zur Erkrankung führt. "Der Auslöser ist in den meisten Fällen ein viraler Infekt", weiß Stingl. Bei manchen Patienten kommt es nach einer Grippe zum Ausbruch, bei anderen - so wie auch bei Rea - nach einer Infektion mit dem an sich harmlosen Epstein-Barr-Virus. "Bei manchen war es ein schwerwiegender Infekt, der mehrere Wochen lang angedauert hat, bei anderen eine banale Infektion. Es gibt kein durchgängiges Muster." Oft wisse man gar nicht, welches Virus der Erkrankung zugrunde lag.
Stress begünstigt den Ausbruch
Stress begünstigt die Erkrankung. Indem er das Immunsystem schwächt, macht er den Körper anfälliger für schwere Infekte, die wiederum zum Ausbruch von ME/CFS führen können. Genauso wie schwere Verletzungen, Operationen, eine Schwangerschaft oder Geburt. "Das ist ja auch Stress", gibt der Facharzt zu bedenken. "Ich hatte schon einige Damen, die nach der Geburt die typischen Symptome entwickelt haben - oft verkannt als postnatale Depression." Mit dem Unterschied, dass die Symptome nicht wieder verschwunden, sondern anhaltend geblieben sind.
Bei überproportional vielen ME/CFS-Patienten lässt sich auch ein Immundefekt diagnostizieren. Dabei müsse es sich keineswegs um einen schwerwiegenden Defekt handeln. Oft trete dieser lediglich durch eine verstärkte Anfälligkeit für HNO-Infekte oder Blasenentzündungen zutage. Durchaus denkbar sei es auch, dass ME/CFS genetisch bedingt ist, gibt es doch Familien, in denen gleich mehrere Mitglieder betroffen sind. Schließlich dürften auch Umweltfaktoren wie etwa eine Belastung durch Schwermetalle eine Rolle spielen, die, für sich genommen, noch nicht allzu problematisch ist.
Auch interessant: So viel Gift steckt in unserem Alltag
"Die Kombination der Faktoren ist ausschlaggebend", fasst der Neurologe zusammen. "Das macht es oft auch so schwierig. Man kann die Erkrankung nicht an einem Punkt festmachen." Schwierig und vor allem lange war auch Reas Weg bis zur Diagnose. Sie ist eine von schätzungsweise 25.000 Österreichern, die am chronischen Erschöpfungssyndrom leiden. Allerdings bevorzugt sie die Bezeichnung ME/CFS. "Das hat mit Müdigkeit und Erschöpfung, die ein gesunder Mensch nach einem intensiven Arbeitstag verspürt, absolut nichts zu tun. Es ist wie eine schmerzhafte Schwäche am ganzen Körper, die nach Anstrengung auftritt", beschreibt sie die Symptome der Erkrankung.
Ich war einfach nur mehr ausgelaugt. Jeder Tag war ein Kampf
ME/CFS trifft deutlich mehr Frauen als Männer. Zum Ausbruch kommt es meist im Alter von 15 bis 35 Jahren. Als sich bei Rea erstmals Symptome zeigten, war sie 18. "Als Studentin konnte ich das noch irgendwie schaukeln, dass ich meinen Alltag trotz der Erschöpfung und den häufigen Infekten bestehe." Als sie dann aber als Lehrerin an einer MNS zu unterrichten begann - ihre Fächer waren Deutsch und Musik -, verschlechterte sich ihr Zustand zusehends. Eine Verkühlung folgte der anderen. Starke Konzentrations- und Schlafstörungen kamen hinzu. "Ich war einfach nur mehr ausgelaugt. Jeder Tag war ein Kampf", erinnert sich die heute 27-Jährige.
Eine Psychotherapie half ihr, mit der Situation besser zurechtzukommen. Vom Psychiater bekam sie Schlafmittel verschrieben. Was sie hatte, das konnte ihr allerdings niemand sagen. Nach drei Jahren Lehrtätigkeit wurde sie Klassenvorständin. "Ich war von Schulbeginn an sehr gefordert. Da hatte ich dann zwei Infekte direkt hintereinander. Von denen hab ich mich nicht mehr erholt." Ihren Beruf musste die junge Frau an den Nagel hängen. "Ich hab noch ein paar Mal probiert arbeiten zu gehen, bin dann aber sofort wieder im Bett gelegen. Tagelang." An Arbeiten war nicht mehr zu denken.
Sieben Jahre bis zur Diagnose
Es folgte ein Spießrutenlauf auf der Suche nach dem Grund. "Beim Psychiater hab ich einen Testbogen ausgefüllt - und auf einmal war ich schwer depressiv. Für mich hat das aber überhaupt keinen Sinn gemacht. Weil zu Schulbeginn war total glücklich war. Ich war voll motiviert und hab mich auf meine Klasse gefreut." Von CFS las sie erstmals in einem Zeitungsartikel. Über diesen erfuhr sie auch von Dr. Stingl. "Er war der erste Arzt, der mich in meinen Beschwerden gehört und ernst genommen hat." Sieben Jahre dauerte es bis zur richtigen Diagnose.
Das hat mit Erschöpfung, die ein gesunder Mensch nach einem intensiven Arbeitstag verspürt, absolut nichts zu tun
Wie man sich fühlt, wenn man eine solche bekommt? "Einerseits war ich erleichtert - das Kind hatte endlich einen Namen und man weiß, womit man es zu tun hat. Anderseits war die Diagnose anfangs ein großer Schock." Wer an ME/CFS leidet, muss mit seiner Energie sehr gut haushalten. "Der Alltag mit so einer Einschränkung ist sehr schwierig. Es erfordert viel Disziplin, nicht über seine Grenzen zu gehen. Ich würde gerne viel mehr machen, muss mich aber immer zurücknehmen. Und den ganzen Tag ruhen zu müssen, kann auch sehr frustrierend sein", schildert Rea.
Die Krankheit zwang sie nicht nur, ihren Alltag komplett umzustellen. Auch ihre Identität musste sie neu definieren. Plötzlich kann der Selbstwert nicht mehr an der erbrachten Leistung festgemacht werden. "Ich musste mein Selbstbewusstsein komplett neu aufbauen." Auch existenzielle und Zukunftsängste sind ihr nicht fremd. Derzeit bezieht Rea Rehabilitations-Geld. Um dieses muss sie Jahr für Jahr ansuchen. Der Gutachter entscheidet, ob sie in der Lage ist, wieder arbeiten zu gehen. "Es ist jedes Mal ein Bangen. Man fühlt sich so ausgeliefert."
Keine zentrale Anlaufstelle
"Man kann CFS nicht in dem Sinn beweisen, dass man einen Laborwert hat und sagt: 'Aha, das ist es'", erklärt Stingl. Würde man aber genauer hinsehen, könne man vielen Patienten eine falsche Therapie ersparen, durch die sich ihr Zustand mitunter weiter verschlechtert. Für die Diagnose ist eine Reihe an Untersuchungen notwendig, die zu bekommen es "teilweise ewig dauert". Die Krankenkasse zahlt bei weitem nicht alle. Den Rest der Kosten muss der Patient stemmen. Vor allem aber fehle es Stingl zufolge an einer Anlaufstelle für Betroffene. "Die Patienten kommen zum Teil aus Vorarlberg zu mir."
Ob man seinen Beruf weiterhin ausüben kann, hängt schließlich vom Schweregrad der Erkrankung ab. "Einige wenige können Vollzeit arbeiten, brauchen dann aber die Freizeit, um sich zu regenerieren. Andere kommen kaum mehr aus dem Bett. Irgendwo dazwischen spielt es sich ab", weiß Stingl. Nicht zuletzt spielt auch der Zeitpunkt der Diagnose eine Rolle. Je früher man sich zu schonen beginnt, desto eher kommt es zu einer Stabilisierung oder gar zu einer langsamen Verbesserung. Eine vollständige Genesung tritt allerdings nur in den seltensten Fällen ein.
Manche können Vollzeit arbeiten, andere kommen kaum mehr aus dem Bett. Irgendwo dazwischen spielt es sich ab
Dass selbst manch Arzt die Erkrankung nicht ernst nimmt, ist ein Problem. Mehr als einmal habe Rea sich sagen lassen müssen, dass ME/CFS eine Missbrauchsdiagnose sei, verwendet von Personen, die nicht arbeiten gehen wollen. "Meine Familie und meine Freunde unterstützen mich sehr. Ich kann so etwas irgendwie wegstecken", sagt die 27-Jährige. Manche Menschen zerstöre eine derartige Aussage aber regelrecht. Der Kampf, in seiner Erkrankung ernst genommen zu werden, erfordert viel Kraft. Kraft, die man eigentlich für die Genesung bräuchte.
Die unsichtbare Krankheit
"Viele wundert es, dass man so normal ausschauen kann. Man glaubt immer, man sieht die Krankheit." Oft sei das aber nicht der Fall. Und vor allem: "Ich bin eine junge Frau. Ich mag ja auch einmal schön ausschauen. Warum sollte ich jeden Tag herumlaufen wie ein Vampir?". Wenn es ihr besser geht, stehen Erledigungen auf dem Programm. Gelegentlich gönnt sich Rea auch einen Spaziergang oder ein Treffen mit Freunden. "Manche Leute denken sich dann: 'Der geht's ja eh gut.' Was sie aber nicht sehen, sind die Tage danach, die ich hauptsächlich im Bett oder auf der Couch verbringe und an denen ich froh bin, dass ich etwas zu essen habe und nicht rausgehen muss. Das würde ich an schlechten Tagen auch gar nicht schaffen."
Das Tückische an der Krankheit, so Rea, sei, dass sie so unberechenbar ist. Im einen Moment noch fühlt man sich den täglichen Aufgaben gewachsen, im nächsten ist man kraftlos und erschöpft. Vorausplanen sei unter diesen Bedingungen unmöglich. Studien zufolge trifft ME/CFS häufig Personen, die sehr leistungs- und zielorientiert sind. "Die auch dann nicht Ruhe geben, wenn sie sich nicht ganz fit fühlen", ergänzt Stingl. Eine grundsätzlich positive Charakterstruktur wird ihnen zum Verhängnis. Denn "egal, wie stark man ist - es wird einem schlechter gehen, wenn man es übertreibt", erklärt der Neurologe.
Das Tückische an der Krankheit ist, dass sie so unberechenbar ist
Rea hat gelernt, ihre Grenzen zu akzeptieren. Akzeptieren muss sie auch, dass es nach wie vor keine ursächliche Behandlung gibt. Lediglich gegen Symptome wie Schmerzen, Schlafstörungen oder Kreislaufprobleme kann man vorgehen. Mit der Corona-Pandemie könnte sich das ändern. Viele Covid-Patienten brauchen Wochen, wenn nicht gar Monate, um sich vollständig von der Erkrankung zu erholen. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein coronaspezifisches Problem ist", sagt Stingl, der hinter den Corona-Spätfolgen ein klassisches postvirales Erschöpfungssyndrom ortet.
Passend dazu: Die möglichen Spätfolgen einer Corona-Infektion
Die Corona-Pandemie als Chance
Erstmals bietet sich damit die Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen einer Infektion und ME/CFS bei einer großen Anzahl an Patienten zu untersuchen, um so die dahinter liegenden Mechanismen zu beleuchten. Bisher konnte man nur Vermutungen darüber anstellen, welche Rolle das Immun-, das Nerven- und das Hormonsystem bei der Entstehung von ME/CFS spielen. Stingl hofft, "dass nun endlich Geld für die Forschung in die Hand genommen und CFS nicht von vornherein als psychosomatische Erkrankung abgetan wird. Das ist eine Riesenchance."
Neue Möglichkeiten haben sich auch durch den Trend zum Homeoffice aufgetan. "Allein der Weg in die Arbeit würde mein tägliches Kontingent an Energie verbrauchen", schildert Rea, die sich für Menschen mit chronischen Krankheiten mehr Möglichkeiten wünscht, an der Arbeitswelt teilhaben zu können. "Da braucht es sinnvollere Lösungen. Damit nicht so viele Leute aufgrund der Krankheit in der Armut landen." Die junge Frau gibt die Hoffnung jedenfalls nicht auf. Zu wissen, dass sie mit der Erkrankung nicht alleine ist, gibt ihr Kraft, um jeden Tag aufs Neue aufzustehen und weiterzukämpfen.