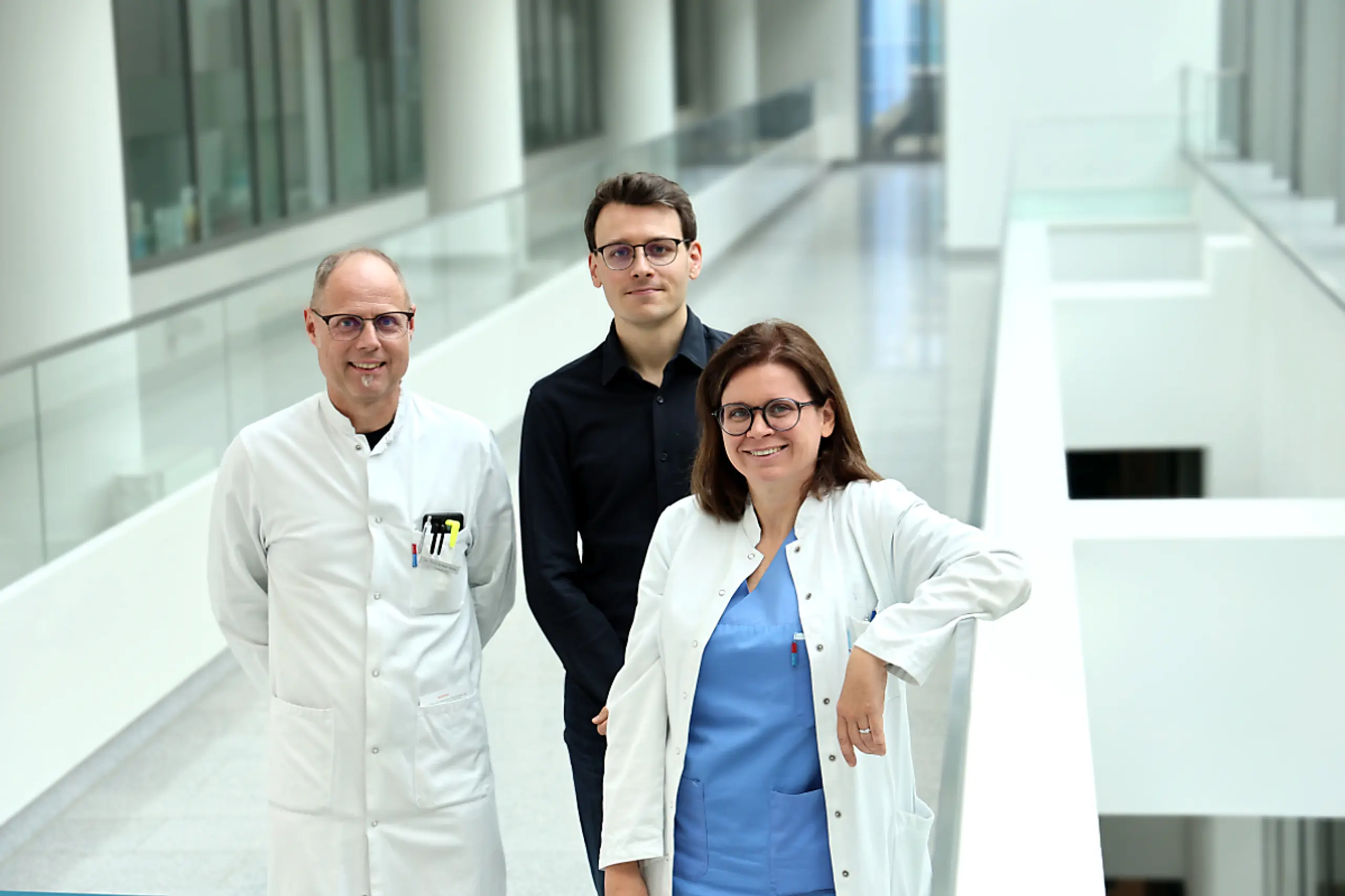von
Flächendeckend verfügbarer Wasserstoff gilt als ein Schlüssel der Dekarbonisierung unserer Zukunft - von der Produktion nachhaltiger Kraftstoffe, über den emissionsfreien Antrieb für die Hochseeschifffahrt und den Schwerverkehr bis hin zu wasserstoffbeheizten Industrieöfen. Doch die Wasserstoff-Forschung hat noch viel zu leisten. An der TU Graz wurden dazu zehn Millionen Euro investiert: Das neue Testzentrum bietet nunmehr eine Infrastruktur zur Entwicklung und Erprobung von Wasserstofftechnologien im industriellen Maßstab.
"Mit dieser hochmodernen Forschungsinfrastruktur schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Position als führende Wasserstoff-Universität Österreichs von internationalem Ruf weiter zu stärken", betonte Horst Bischof, Rektor der TU Graz. Nun will man "Hand in Hand mit Industrie, Wissenschaft und Wirtschaft" die nächste Generation klimafreundlicher Energietechnologien entwickeln.
Alleine in das neue H2-Elektrolyse-Testzentrum sind 4,5 Millionen Euro geflossen. Auf einem 250 Quadratmeter großen Testfeld stehen Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 1,6 bis 2,5 Megawatt. Eine eigene Trafostation sorgt für eine stabile Stromversorgung, die es ermöglicht, bis zu 50 Kilogramm grünen Wasserstoff pro Stunde zu erzeugen. Der Wasserstoff wird über eine Pipeline zum Speichertank geleitet. Die Forschenden nutzen den grünen Wasserstoff, um an neuen und erweiterten Prüfständen die nächste Generation von Großmotoren, Turbinen, Wasserstoffbrennern und Brennstoffzellen-Stacks realitätsnah zu testen.
Weitere 5,5 Millionen Euro fließen in einen neuen Prüfstand für Brennstoffzellen-Stacks, Erweiterungen der Prüfstände für Hochtemperaturbrenner, eine Gasmischstation, Kompressoren sowie Analyse-, Mess- und Sicherheitstechnik. Zusätzliche sieben Millionen Euro werden übrigens an der Montanuni in Leoben in den Wasserstoffbereich investiert. Dort werden die Aktivitäten im "HY-CARE" - Hydrogen and Carbon Research Center Austria" gebündelt.
Noch sei die Erzeugung von Wasserstoff unter realitätsnahen Bedingungen "aufwendig und sehr teuer", mit dem aktuellen Ausbau an der TU Graz könne nun aber daran gearbeitet werden, das Verfahren effizienter und damit kostengünstiger zu gestalten, wie Elmar Pichl, Hochschulsektionschef im Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, hervorhob. Die Investition sei ein entscheidender Schritt, um das Ziel, die Klimaneutralität Österreichs bis 2040 zu erreichen. Der steirische Wirtschafts- und Forschungslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) betonte ebenso, dass Wasserstofftechnologien wesentlich seien, um die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben. Im neuen Testzentrum erkannte er zugleich eine Stärkung der Sichtbarkeit und der führenden Position der Region in der Wasserstoffforschung.
Alexander Trattner vom Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme der TU Graz hob die idealen Bedingungen für Langzeittests und die Analyse von Elektrolyseanlagen hervor. "Damit eröffnen sich neue wissenschaftliche Möglichkeiten für Langzeit- und Belastungstests sowie für Systemanalysen unter praxisnahen Bedingungen", betonte auch Viktor Hacker, Sprecher des Research Centers for Green Hydrogen and Fuel Technologies. Er würdigte auch die enge wissenschaftliche Vernetzung am Standort Graz - "von der materialwissenschaftlichen Grundlagenforschung über Tests im Labormaßstab bis hin zur vorindustriellen Anwendung im Megawattbereich".
So soll etwa mit Hilfe eines neuen Prüfstands für Brennstoffzellen-Stacks deren Effizienz und Lebensdauer erhöht und der Einsatz von u. a. Platin reduziert werden. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf der Optimierung von kombinierten Elektrolyse-Brennstoffzellen-Geräten, die flexibel Wasserstoff erzeugen oder Strom generieren. Zu den Hauptabnehmern des Wasserstoffs zählen auch die Prüfstände für industrielle Hochtemperaturbrenner am Institut für Wärmetechnik, wo Wasserstoff-Erdgas-Mischungen bei Abgastemperaturen von 800 bis 1.500 Grad Celsius in einem Leistungsbereich von bis zu 1,2 Megawatt untersucht werden.
Organisiert ist die Wasserstoff-Forschung in Graz im Research Center for Green Hydrogen and Fuel Technologies. Vier TU Graz-Institute und drei COMET-Zentren mit insgesamt rund 250 Forschenden decken dort das gesamte Spektrum von der Grundlagenforschung über die Wasserstoff-Erzeugung, Speicherung und Verteilung bis hin zur Nutzung in Fahrzeugen, Kraftwerken und industriellen Anwendungen ab.
GRAZ - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Wolf/TU Graz
GRAZ - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Wolf/TU Graz