„Trennen Sie sich von Überflüssigem und erreichen Sie maximale Lebensfreude!“, ist eine verlockende Formel, zugleich aber ein komplexes Konstrukt ohne Anspruch auf absolutes Glück. Von Ulrike Potmesil
Moderner Minimalismus ist ein Wohlstandskonzept in einer von Überfluss geprägten Welt, die Antithese zum marktorientierten Kapitalismus, entstanden in den reichen Ländern der Erde, in Konsumgesellschaften. Denn wer im großen Stil entrümpelt, muss eine Voraussetzung erfüllen: viel zu besitzen. Jene, die sich bewusst dafür entscheiden, feiern ihren persönlichen Wertewandel, sie verfügen über ausreichend finanzielle Ressourcen, um sich freiwillig von Besitz trennen zu können – mit der Option, ihren Verzicht rückgängig zu machen. Ein unrealistisches Konzept für Menschen, die in materieller Armut leben und zum Minimalismus verdammt sind. “Bringe Leichtigkeit in dein Leben, trenne dich von allem Unnötigen!” Eine Empfehlung, die für Arme und Armutsgefährdete nach Hohn klingt. Wer wenig hat, will lieber mehr als noch weniger. Minimalistinnen führen stolz ihre kargen Kleiderschränke vor, während Arme ihre leeren Kühlschränke verschämt verbergen. Wer zum Prekariat gehört, ist kein Minimalist.
Auf Social-Media-Kanälen tummeln sich jene, die diesen Lifestyle mit Leidenschaft leben und andere dafür via YouTube & Co. begeistern. Sie geben Tipps zur perfekten Organisation des Kleiderschranks oder zur Reduktion des Hausrats und führen die Philosophie ihres Lebensmodells aus. Wer durch die Seiten der Minimalismus-Blogger und -Bloggerinnen scrollt, findet „Erfolgsstorys”. Entrümpeln soll Stress reduzieren, Produktivität steigern, Zeit und Geld sparen, Ordnung in Haus und Leben sowie etliche Selbsterkenntnis-Punkte bringen.
Askese
Die Philosophie der Flucht aus dem Leidensdruck des Überangebots an Konsumgütern durch Reduktion von Besitz und ethische Diskussionen zu menschlichen Bedürfnissen ist Tausende Jahre alt. Der indische Prinz Siddharta Gautama, aka Gautama Buddha, ist einer der ältesten Protagonisten der Askese. Der Gründer der buddhistischen Lehre schwor im fünften Jahrhundert vor Christus allen irdischen Gütern ab und lehrte den “mittleren Pfad”, ein Leben zwischen Askese und Luxus. Hundert Jahre später betrat der griechische Philosoph Diogenes von Sinope, der im vierten vorchristlichen Jahrhundert gänzlich ohne materiellen Besitz in einem Vorratsfass gelebt haben soll, die Bühne.
„Mein Körper strömt über vor Leichtigkeit, wenn ich von Brot und Wasser lebe, und ich spucke auf die Freuden des prachtvollen Lebens”, wird der griechische Philosoph Epikur im dritten Jahrhundert vor Christus zitiert. Ebenso wählten Franziskus von Assisi und Mahatma Ghandi ein Leben in Armut als Protest gegen eine materiell orientierte Gesellschaft.
Der Begriff Minimalismus stammt ursprünglich aus der US-amerikanischen Kunstszene der 60er-Jahre. Die Minimal-Art-Strömung etablierte sich als Gegenentwurf zum überbordenden Abstrakten Expressionismus und reduzierte Kunst auf das Wesentliche. Die Philosophie des Strebens nach weniger ist vielschichtig. Sie beginnt pragmatisch bei der Entrümpelung des persönlichen Besitzes, führt zur Reduktion der Termine und belastenden sozialen Kontakte bis zur Neuordnung des gesamten Lebens. Qualität vor Quantität soll der Schlüssel für Klarheit und Sinnstiftung im Leben sein. Übrig bleibt das, was dem Leben Mehrwert verleiht.
Die japanische Aufräum-Queen Marie Kondō, Ikone der modernen Minimalisten, entwickelte daraus ein Geschäftsmodell, sie mistet bei ihren Kundinnen und Kunden radikal aus. Ihre Philosophie ist an die des Zen-Buddhismus angelehnt, dessen Grundpfeiler Reduktion des Besitzes ist. Zen-Mönche sind per Definition Minimalisten, historisch ebenso wie in der Rezeption. „Does it spark joy – macht es mich glücklich?”, ist die Frage, die man laut Kondō jedem Gegenstand stellen soll, bevor man sich für oder gegen ihn entscheidet. Das gilt ausnahmslos für jedes Ding, von den Socken bis zu den Jugenderinnerungen. Radikalität, die viele Kritiker findet, denn die Heftklammern im Büro entfachen nun mal keine Glücksmomente, ebenso wenig wie Putzmittel und Wäscheklammern. Ohnehin lehnen viele Minimalisten abseits der asiatischen Zen-Lehre kompromisslose Ausmistaktionen ab, sehen ihren Lebensstil als langsamen Weg, nicht als radikale Veränderung, setzen auf Balance zwischen Freude und Notwendigkeit.
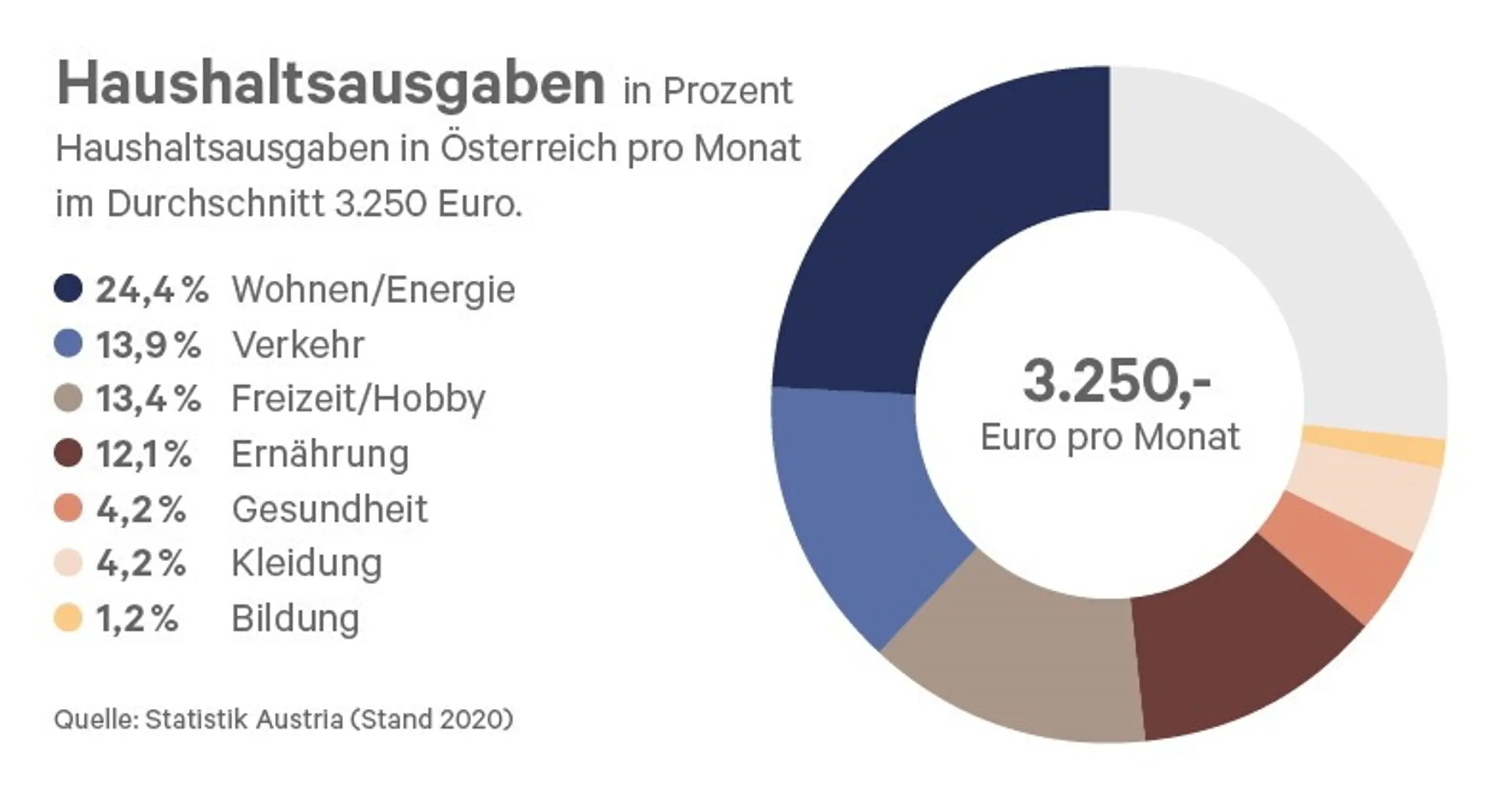
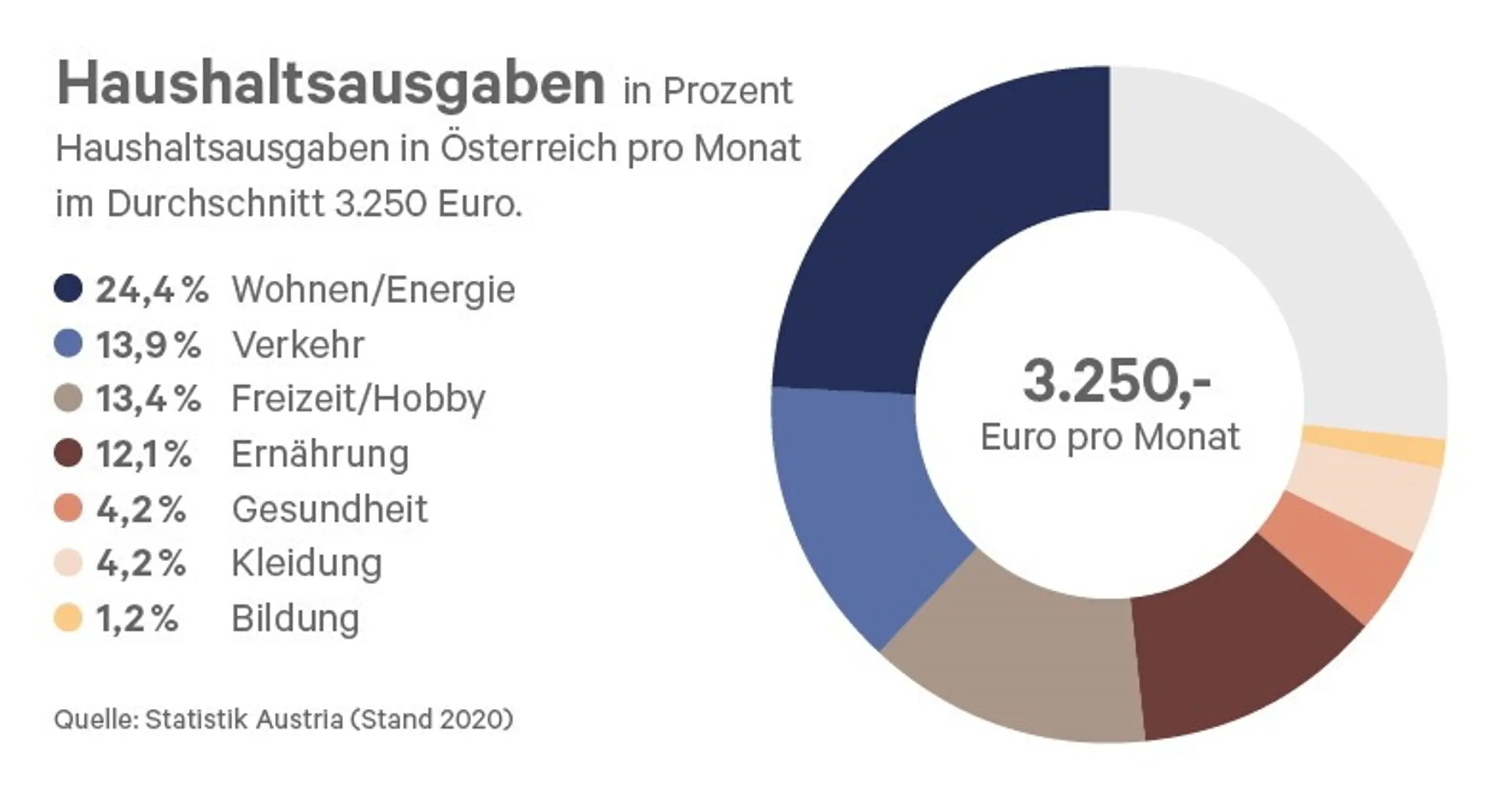


Virtueller Overkill
Wer sich mit dem Loslösen von irdischen Gütern beschäftigt, entdeckt bald den Überfluss immaterieller Dinge. Unsere digitale Welt wächst exponentiell, weltweit häuft sich Besitz an virtuellen Daten, deren Speicherplatz nahezu grenzenlos ist, wir archivieren Tausende Megabyte. Fotos, Apps, Dokumente, Geld auf unseren Konten – „digital Hoarding”.
Davor sind auch jene nicht gefeit, die als digitale Nomaden leben: Menschen ohne festen Wohnort mit geringem Besitz, die rund um den Erdball jetten – und dabei Datenfluten produzieren. Viele moderne Nomaden sind finanziell gut abgesichert, beanspruchen für sich zwar wenig materiellen Ballast, verfügen gleichzeitig über Zugang zu Luxus: Hotelzimmer mit Flat-TV und Internetzugang, Mietautos. Die gehorteten Daten sind masseloser Ballast, befinden sich in der Cloud oder auf einem Server. Dass die Cloud keine Schäfchenwolke ist, sondern Rechenzentren mit aufwendig gekühlten Reinräumen beansprucht, die so viel Strom wie Kleinstädte benötigen, wird als Preis der Freiheit in Kauf genommen.
Kann Minimalismus maximale Zufriedenheit bringen? Letztendlich ist er keine Doktrin, sondern ein variables Lebensmodell für jene mit gesellschaftspolitischer und monetärer Basis. Vom Leben im Wohlstand, umgeben von stylischem und funktionalem Besitz, bis zu radikaler Konsumverweigerung: Minimalismus ist Vielfalt.
Theresa Dutzler: „Reise ohne Endpunkt“
Theresa Dutzler ist Minimalistin ohne Perfektionsanspruch, ihre Philosophie beruht auf Nachhaltigkeit.
Wie wird man Minimalistin?
Mir fiel Marie Kondōs Buch “Die lebensverändernde Magie des Aufräumens” in die Hände, das war der Beginn meiner Reise. Es kamen weitere Bücher wie Nunu Kallers “Ich kauf nix!” und Carl Tillessens “Konsum – Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen”. Ich habe mich ein Jahr mit dem Thema theoretisch auseinandergesetzt, bevor ich zur Tat geschritten bin. Minimalismus ist ein langer Prozess ohne Endpunkt, auch nach Jahren gibt es in meinem Leben noch Reduktionspotenzial.
Können Sie Ihren Besitz beziffern?
Nein, denn die Zahl ist nicht entscheidend, dagegen hinterfrage ich Gewohnheiten: Was besitze ich, was brauche ich, was macht mich glücklich? Beim radikalen Entrümpeln unseres Hausstands sind uns kuriose Dinge wie etwa 25 Brillenputztücher unter die Hände gekommen! Jetzt sage ich grundsätzlich Nein zu unnötigen Gratisartikeln. Um klarzustellen. Wir leben nicht auf 40 Quadratmeter Wohnfläche mit zwei Kaffeehäferln und zwei Küchenstühlen, sondern in einem Haus mit Garten. Jeder braucht andere Dinge, um sich wohlzufühlen. Trenne dich nie von einem guten Gefühl! Leseratten sollen sich nicht von ihrer Bibliothek trennen, nur weil sie die Bücher kein zweites Mal lesen werden. Eine Freundin näht in ihrer Freizeit, ihre umfangreiche Nähgarnsammlung zu entsorgen, wäre also kontraproduktiv. Ich dagegen habe meine unbenutzte Nähmaschine verschenkt.
Wie entrümpelt man nachhaltig?
Wir haben gespendet, am Flohmarkt verkauft und verschenkt. Mittlerweile besitzen wir nichts, das wir nie verwenden.
Was bewirkt Ordnung mental?
Sie bringt Klarheit, gibt mir die Chance, mich besser zu fokussieren. Zudem muss ich weniger aufräumen und gewinne Zeit – praktisch und mental. Die nutze ich bewusst, stelle mir etwa einen Timer, wenn ich in sozialen Medien arbeite. Mit leichtem Rucksack bleibt mehr Raum für Kreativität und so habe ich meine Ziele neu definiert, eine Ausbildung zur Glücks- und Resilienztrainerin absolviert, meinen Job im Industriemarketing gekündigt und mich selbstständig gemacht. Jetzt arbeite ich als Trainerin und führe eine kleine Werbeagentur mit dem Slogan: “Minimal ist in”.
Welche Grundsätze vermitteln Sie?
Ich urteile nicht, bekehre niemanden, sondern gebe meine Werte weiter: Nachhaltigkeit und Ressourcenbewusstsein. Wenn es für eine Kundin befreiend ist, einfach nur die Küche zu entrümpeln, ist das auch okay. Eine Workshopteilnehmerin hat mich danach entsetzt angerufen. Sie hatte sagenhafte 250 Sockenpaare gezählt. Auch das ist Bewusstseinsbildung, es muss ja nicht jeder sein gesamtes Leben umkrempeln.


Dieser Beitrag erschien ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 11/2025.
