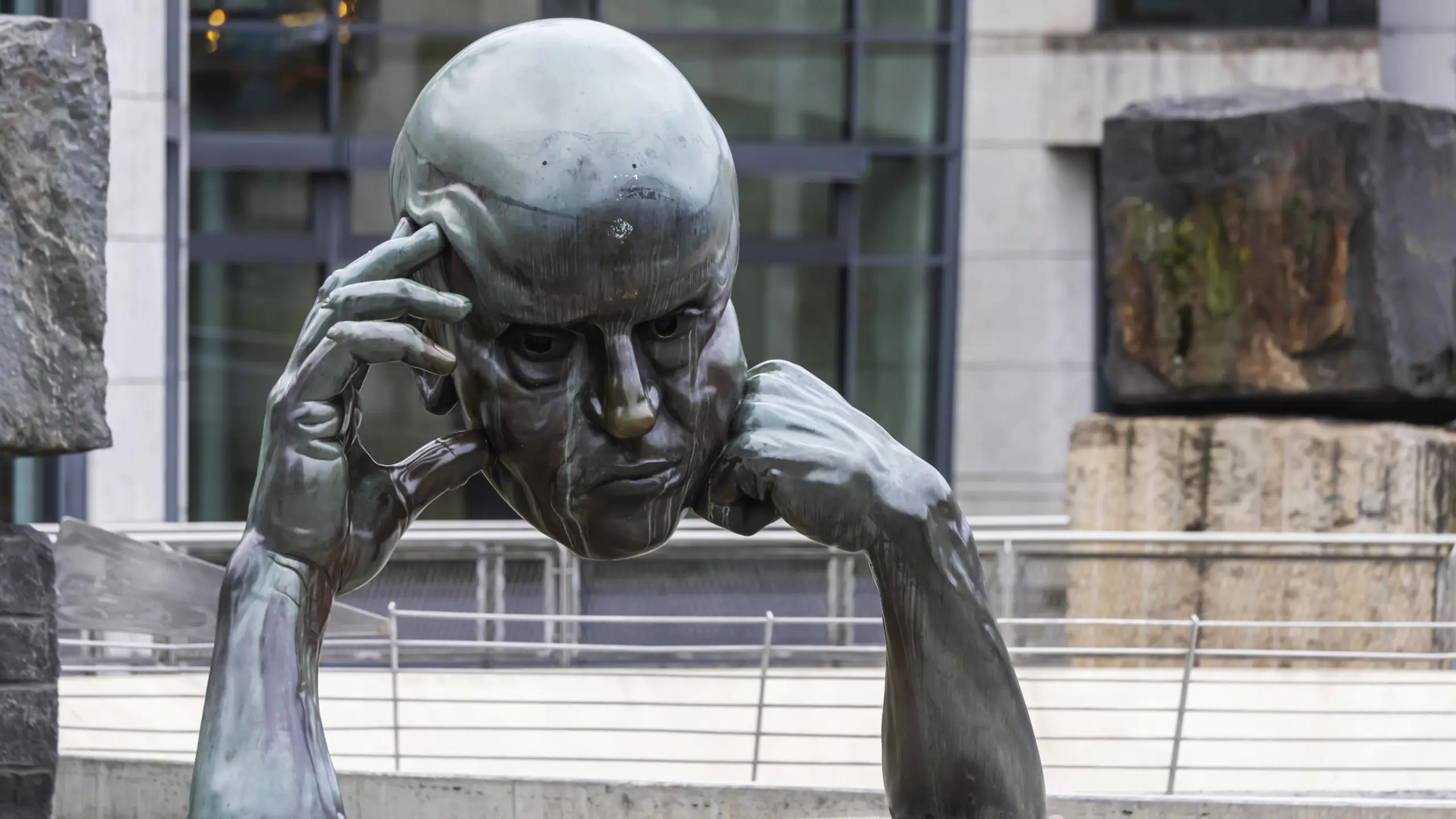Der öffentlichen Debatte ist das Denken abhandengekommen. Statt dass Argumente aufeinanderträfen, prallen Parolen aneinander vorbei, die Verteidiger des Guten operieren mit denselben Mitteln wie die bösen Angreifer.
Schon wieder habe ich einen Brief aus der Schweiz erhalten. Absender: Die „Republik“, ein seit 2018 existierendes Onlinemedium, dessen Genossenschafter ich am Anfang war, weil ich der Ansicht war und bin, dass zahlendes Publikum für die Unabhängigkeit von Medien wichtiger und besser ist als die Güte der Herrschenden, seien es Despoten oder Demokraten. Mäzene finde ich aus eigener Erfahrung auch sehr hilfreich, aber hier beginnt bereits das Problem: In einer Zeit, in der Denken als moralische Schwäche gilt, gibt es für die Vorstellung, dass zwei wohlhabende Menschen je nach Wertegerüst die eine oder die andere Sache unterstützen und dafür auf die gleiche Weise respektiert werden, keinen Platz. Heute würde niemand mehr von zwei Mäzenen reden, stattdessen würde der jeweils andere Mäzen als Oligarch denunziert, der sich in sinistrer Absicht ein Medium gekauft hat. Aber das ist eine andere Geschichte, auf die man allerdings vielleicht noch zurückkommen wird.
Zunächst aber zum Brief der „Republik“ aus der Schweiz. Er war zwar mit einer Frage überschrieben („Erleben wir gerade das Ende der liberalen Weltordnung?“), enthielt aber ausschließlich Antworten, was schade war, weil man, hätte es sich tatsächlich um eine Frage gehandelt, zunächst einmal mit der Gegenfrage hätte antworten können, was denn eine liberale Weltordnung eigentlich sei und ob es sie je gegeben hat.
Antworten, altbekannte
Stattdessen gab es aber Antworten, und zwar altbekannte. Ich zitiere: „Ohne Journalismus keine Demokratie. Und ohne Demokratie keine Freiheit. So beginnt das Manifest der Republik. Und deswegen ist die Republik 2018 angetreten: um als unabhängiges, kritisches Magazin ihre Rolle als Teil der vierten Gewalt ernst zu nehmen. Und so einen Beitrag zu leisten zu einer Demokratie, die diesen Namen verdient. Von Anfang an bedeutete das, dass wir überall dort besonders genau hinschauen, wo die Demokratie unter Druck kommt. Das war nie nötiger als jetzt, wo demokratische Normen weltweit bröckeln. Nicht nur in Ländern wie Ungarn oder der Türkei, die mit dem Schnellzug Richtung Autokratie unterwegs sind. Sondern auch in den USA.“ Es folgt ein grüner dicker Balken zum Anklicken, und in diesem dicken grünen Balken steht: „Das unterstütze ich“.
Klar, Marketingmails sind immer eine eigene Sache, aber wenn schon die Chefredaktorin eines Mediums, das sich für die letzte Bastion der globalen liberalen Demokratie hält, in die Tasten greift, möchte man doch erwarten, dass das Ergebnis ein bisschen substanzieller ausfällt als das Werbemail für eine Rindertalgcreme. Man könnte das auch für egal halten, aber es zeigt sich, glaube ich, in dieser Art des öffentlichen Denkens und Schreibens ein gesellschaftliches Grundproblem, nämlich: Es führt nirgendwohin, wenn sich diejenigen, die sich gegen simplifizierende, fundamentalistisch-populistische Strömungen zur Wehr setzen, das mit den gleichen Mitteln tun, die auch die Angreifer verwenden. Das fast primitiv zu nennende Moralgerede derer, die sich für die letzte Bastion der Demokratie gegen die anstürmenden „Horden“ von rechts halten (der Begriff „Horden“ kommt in diesem Kontext tatsächlich mit stark steigender Häufigkeit zum Einsatz), offenbart die gleiche gedankliche Schlichtheit wie das selbstmitleidige Gezeter der angeblich vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossenen Herrenreiter.
Wann genau hat man eigentlich in der öffentlichen Auseinandersetzung begonnen, weitgehend auf das Denken zu verzichten?
Zuletzt hat sich das in der Debatte über eine mögliche ORF-Reform gezeigt: Die FPÖ will diese Reform mit einiger Sicherheit nicht durchsetzen, weil sie sich mehr Qualität im öffentlichen Rundfunk wünscht, sondern weil sie simple Rachegelüste befriedigen möchte. Es ist nicht so, dass die „Linksfunk“-Propaganda der Freiheitlichen nicht da und dort auch ein Körnchen Wahrheit bergen würde, aber im Großen und Ganzen handelt es sich einfach um Propaganda. Und man fragt sich, warum dem ORF-Redakteursrat und anderen Repräsentanten des Unternehmens nichts Besseres einfällt, als zu erklären, dass eine 15-prozentige Kürzung der Mittel die „Zerstörung“ des Unternehmens bedeuten würde. Statt dass Argumente aufeinanderträfen, prallen Parolen aneinander vorbei. Wem ist damit gedient, dass man Propaganda mit Gegenpropaganda beantwortet? Wann genau hat man eigentlich in der öffentlichen Auseinandersetzung begonnen, weitgehend auf das Denken zu verzichten?
Natürlich wäre es naiv, dem Mediensprecher der FPÖ, der noch nie zum Subtilitätsexzess geneigt hat, oder dem Vorsitzenden des ORF-Redakteursrats die Lektüre von George Steiners großartig-schmalem Alterswerk „Warum Denken traurig macht“ zu empfehlen, und vor allem wäre es auf eine besonders miese Weise arrogant und herablassend (und ich nehme an, sie haben es ohnehin gelesen). Deshalb würde ich es stattdessen gerne uns allen, die wir mit der öffentlichen Rede beschäftigt sind, ans Herz legen, uns mit Steiners Gedanken anfreunden, dass die Aufgeregtheit, in der wir uns wechselseitig unsere fundamentalistischen Weltverständnisse um die Ohren hauen, nichts anderes sind als eine Ablenkung von der fundamentalen Angst vor dem Nichts, das sich auftut, wenn man wirklich mit dem Denken beginnt. Man muss dann ja ohnehin trotz allem auch etwas tun. Aber vielleicht wird das dann nicht ganz so deppert.
Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: redaktion@news.at
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 6/2025 erschienen.