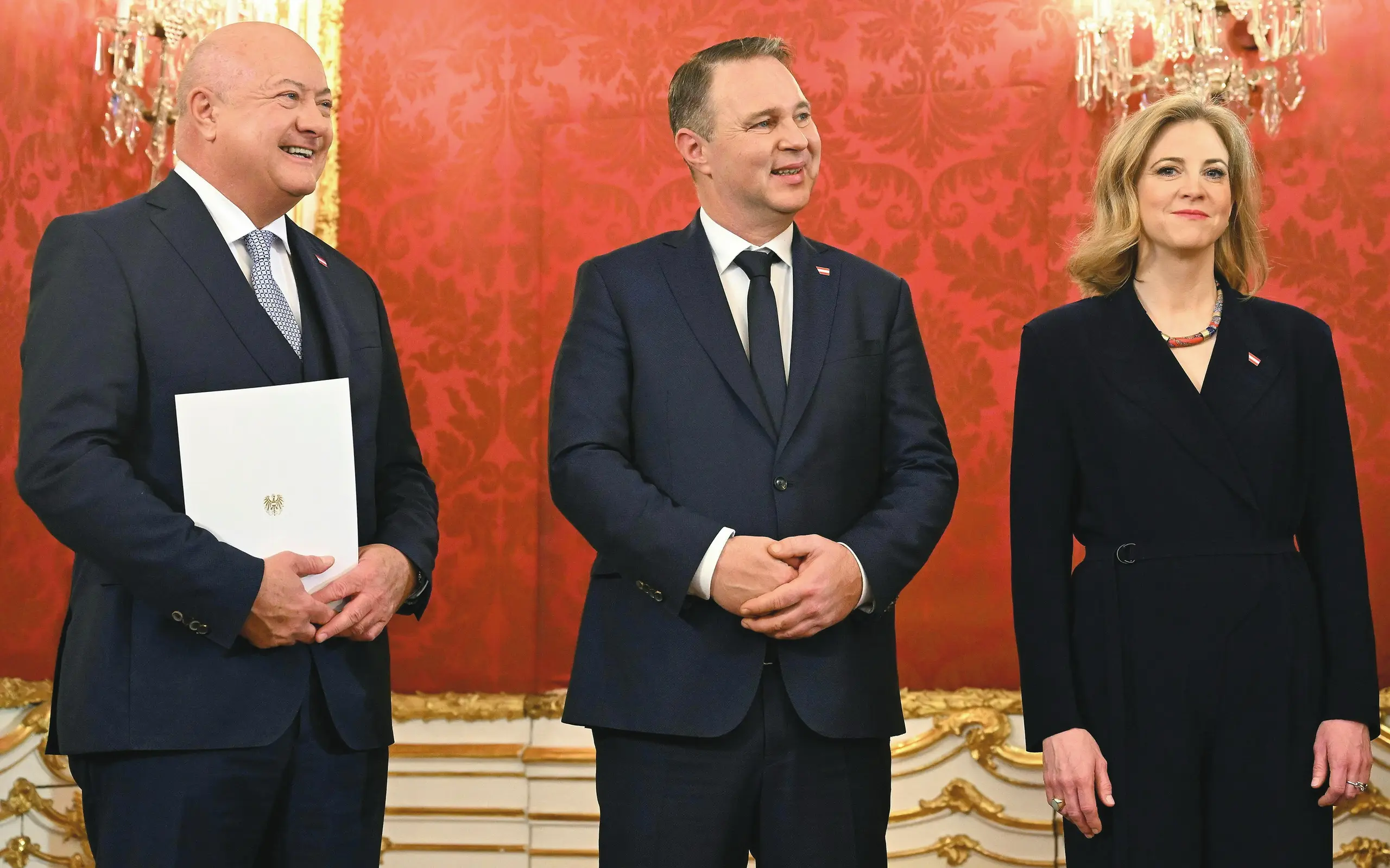In unserer überdrehten Gegenwart scheint es nur zwei Sorten von Männern zu geben: Madmen und Mad Men. Zum geopolitischen Schaukampf der Wahnsinnigen kommt der Kulturkampf, der von einem amorphen digitalen Mob ausgefochten wird. Willkommen im Wahnsinn.
Im Wesentlichen, könnte man sagen, besteht die Welt aus zwei Arten von Männern: Madmen und Mad Men. Ihren Ursprung haben beide in den 60er-Jahren: Die Mad Men der gleichnamigen Fernsehserie (2007–2015) waren die Gottkönige der amerikanischen Werbeindustrie und agierten in deren Zentrum, der Madison Avenue in New York City. Die Mad Men waren Ad Men, also Advertising Men, aber sie waren eben auch ein bisschen verrückt, ganz wie die Umbruchszeit der Kultur- und Weltgeschichte, die in der Serie auf ziemlich geniale Weise beschrieben wird.
Madmen, also einfach nur Verrückte, gab es immer und zu jeder Zeit in nicht geringer Zahl, ob ihre Prävalenz in der politischen Sphäre besonders hervorsticht, lässt sich empirisch nicht so leicht feststellen. Eine regelrechte Madman-Theorie gibt es ebenfalls seit den 60er Jahren, sie wurde von Richard Tricky Dick Nixon etabliert. Der Kern dieser Theorie oder besser Strategie oder eigentlich Taktik besteht darin, das Gegenüber in einer schwierigen Situation glauben zu lassen, man sei nicht mehr dazu in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen, weswegen jederzeit mit einer potenziell tödlichen, jedenfalls zerstörerischen, wenn auch manchmal „nur“ selbstzerstörerischen Irrationalität zu rechnen sei.
Nicht so erfolgreich
Man hatte ein ähnliches Verhalten während der Kuba-Krise dem Generalsekretär der KPdSU, Nikita Chruschtschow, zugeschrieben, allerdings weiß man naturgemäß nie, ob jemand ein Madman ist oder nur einen spielt, was die Strategie übrigens auch so fehleranfällig macht. Man muss sagen, dass es auch bei Nixon nur so lala funktioniert hat. Nixon wollte, so die Überlieferung eines seiner Mitarbeiter, den Vietnamkrieg, der fast 60.000 junge Amerikaner das Leben gekostet hat, dadurch beenden, dass er über geheime Kanäle die geheime Nachricht in den kommunistischen Nordvietnam und in die Sowjetunion sickern ließ, dass der amerikanische Präsident nicht mehr ganz zurechnungsfähig sei und also, wenn es nicht zu einem Ende des Kriegs käme, möglicherweise bis zum Äußersten gehen würde, nämlich bis zum Einsatz von Atomwaffen.
Nixon entschied sich dann, ohne verrückt geworden zu sein, für einen Angriff auf Kambodscha, aber auch diese Strategie funktionierte nur mäßig, aus der „ehrenvollen“ Beendigung des Vietnamkriegs, die er im Wahlkampf 1968 versprochen hatte, wurde nichts, die Amerikaner zogen ab, und der Vietnamkrieg endete 1975 eher formlos und nicht besonders ehrenhaft durch den Einmarsch der Vietkong-Truppen in -Saigon.
Heute stehen einander auf der Weltbühne erneut zwei Männer gegenüber, die man regelmäßig als „Irre“ (eher Putin) oder „Verrückte“ (eher Trump) bezeichnet. Es findet die gleiche Diskussion wie in den 60er-Jahren statt, nämlich ob man es mit strategischer oder tatsächlicher Verrücktheit zu tun habe und ob die Folge einer solchen Strategie der Friede sein würde, den lange keiner zustande brachte, oder eben der Weltuntergang. Ob am Stück oder in Raten, wäre dann sekundär. Man muss nicht Marshall McLuhan sein, um zu verstehen, dass der wesentliche Unterschied zwischen damals und jetzt ein medialer Unterschied ist. McLuhan war ein erzkatholischer Literaturwissenschaftler, der uns schon vor 50 Jahren den heute besonders gültigen Satz geschenkt hat, dass moralische Empörung eine wirksame Methode sei, dem Idioten Würde zu verleihen. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse über das Wesen der elektronischen Medien (sein berühmtestes Theorem: The Medium is The Message) gewann er übrigens ganz wesentlich aus dem Studium der mittelalterlichen Geistesgeschichte.
Egal: Die Madman-Strategie, also der Versuch, sein Gegenüber in einer angespannten Verhandlungslage dadurch zum Einlenken zu bringen, dass man ihm vermittelt, man sei mangels Rationalität buchstäblich zu allem fähig, basierte zu einem guten Stück auf der Möglichkeit der gezielten und kontrollierten Kommunikation, über die heute niemand mehr verfügt.
In einer Welt, in der alle verrückt geworden sind, macht es wenig Eindruck, wenn man den Verrückten spielt
Man könnte auch sagen: In einer Welt, in der alle verrückt geworden sind, macht es wenig Eindruck, wenn man den Verrückten spielt. Mad Men, wohin man schaut. Das gilt nicht nur im Geopolitischen, sondern auch in der kulturellen Sphäre. Es scheint, als würde man die Kulturkämpfe der 60er-Jahre noch einmal kämpfen, bloß in die andere Richtung. Der Pendelschlag zurück von einer völlig überdrehten Wokeness-Ideologie in die Mitte, den viele erwartet und auch erhofft haben, scheint sich zum Todesstoß für alles zu beschleunigen, was sich mehrere Nachkriegsgenerationen erkämpft haben, von der Geschlechtergerechtigkeit bis zur Meinungsfreiheit.
Der Übergang vom links-identitären Spießertum zum rechtsreaktionären Mief und die spektakuläre Verschmelzung der beiden zu einem amorphen digitalen Mob spielt sich in affenartiger Geschwindigkeit ab. Man kommt mit dem Schauen nicht nach, geschweige denn mit dem Denken. Putin ist nicht Chruschtschow, Trump ist nicht Nixon, TikTok ist nicht die „Bild“-Zeitung, und die Wiener Festwochen sind nicht Woodstock. Aber es ist schon erstaunlich, wie massiv das Gefühl der Gegenwärtigkeit ist, wenn man sich dieser Tage eine Folge „Mad Men“ ansieht.
Ich bleibe aber optimistisch. Denn das wirklich Erstaunliche ist doch nicht, dass in einer solchen Situation so viele verrückt werden, sondern dass nicht noch viel mehr verrückt geworden sind.
Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: redaktion@news.at
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 12/2025 erschienen.