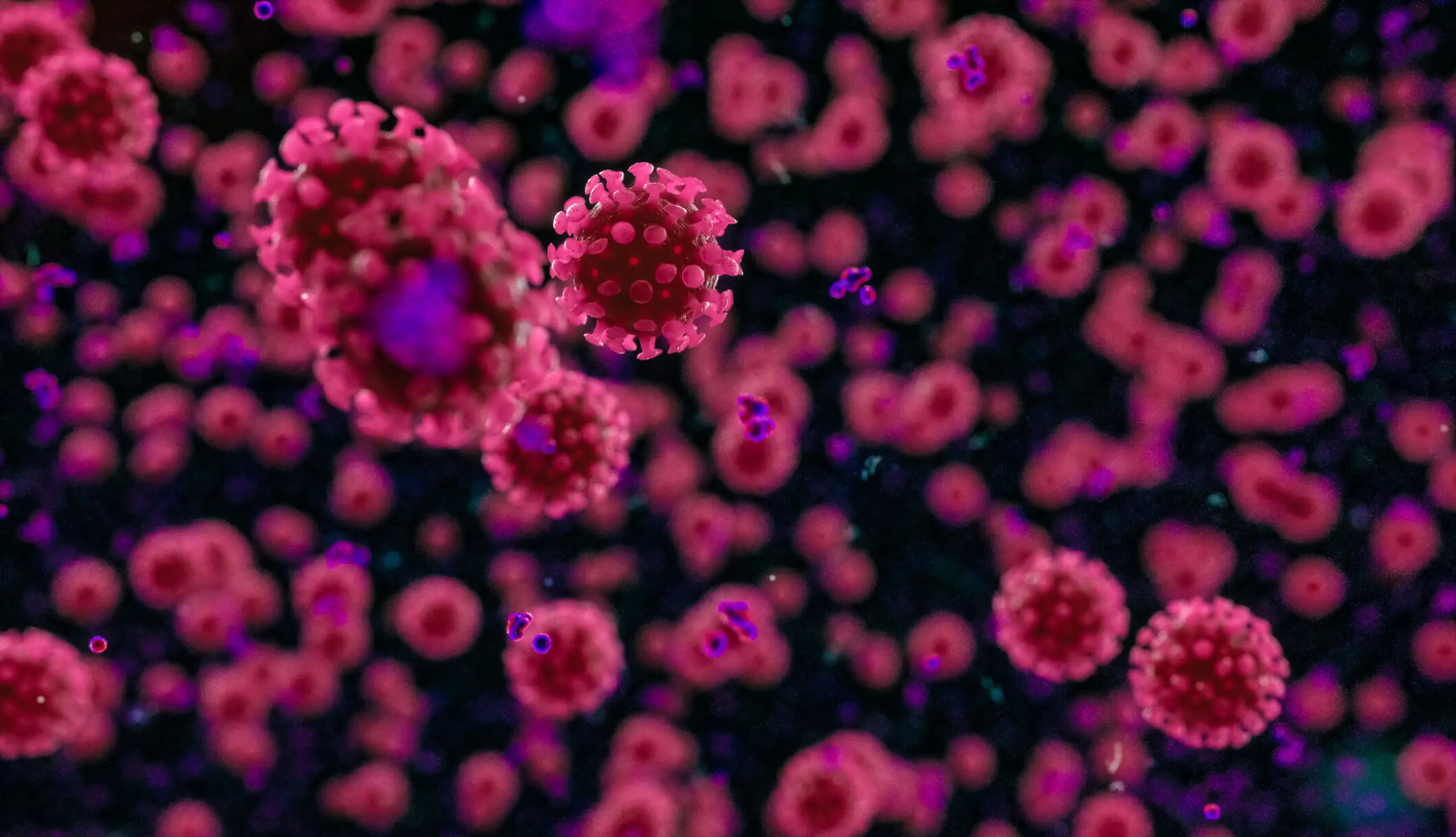Die Gendermedizinerin Kautzky-Willer wurde zur „Wissenschaftlerin des Jahres 2016“ gewählt. Mit der Auszeichnung wird vor allem die Vermittlungsarbeit von Österreichs erster Professorin für Gendermedizin an der Medizin-Universität Wien gewürdigt. Gendermedizin, ein Thema von enormer Bedeutung, das bis dato trotzdem weder in der Öffentlichkeit noch in der Forschungsförderung die Beachtung fand, die es verdient.
Was ist Gendermedizin?
Gendermedizin beschäftigt sich mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Männern und Frauen in allen Bereichen der Gesundheit. Das beginnt bei der Prävention, geht über die Diagnostik bis hin zur Behandlung. Die Berücksichtigung des Geschlechts ist ein wichtiger Schritt zur personalisierten Medizin. Bei dieser wird jeder Patient unter der Einbeziehung individueller Gegebenheiten behandelt. Obwohl seit langem bekannt ist, dass das Geschlecht die Gesundheit maßgeblich beeinflusst, wird diese Erkenntnis sowohl in der Grundlagen- als auch in der klinischen Forschung immer noch stark vernachlässigt.
Das Geschlecht als maßgeblicher Einflussfaktor auf die Gesundheit wird immer noch stark vernachlässigt.
Bei der Gendermedizin muss grundsätzlich zwischen zwei Begriffen unterschieden werden: „Sex“ und „Gender“. Sex meint dabei die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Zu diesen zählen genetische wie hormonelle sowie Unterschiede im Körperbau und bei den Organen. Eine große Rolle spielen vor allem die Sexualhormone. Die beeinflussen nicht nur den Energiehaushalt und Stoffwechsel, sondern auch Dinge wie das Immun- oder das Herz-Kreislauf-System.
Gleich wichtig wie die biologischen sind auch die genderspezifischen Unterschiede. Diese werden durch soziale Faktoren wie Verhalten, Lebensstil, Gesellschaft oder Familie verursacht. Eine genaue Trennung zwischen Sex und Gender ist in der Gendermedizin jedoch nicht möglich – und auch nicht nötig, da sich beide Faktoren gegenseitig beeinflussen. So dürfen sowohl die Gender- als auch die Sex-Unterschiede dafür verantwortlich sein, dass Frauen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% und Männer lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,3 Prozent 100 Jahre alt werden.
Frauen und Männer sind anders krank
Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrem Gesundheitsverhalten wesentlich voneinander. Frauen sind beispielsweise anfälliger für Autoimmun- oder psychische Erkrankungen wie Depressionen. Männer hingegen bekommen früher und häufiger Diabetes und Herzinfarkt. Die Gendermedizinerin Kautzky-Willer meint, wenn man sogenannte Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes gezielter behandeln wolle, müsse man auch deren unterschiedliche Erscheinungsformen bei Frauen und Männern stärker berücksichtigen.
Wenn man Volkskrankheiten gezielter behandeln will, muss man ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen bei Frauen und Männern stärker berücksichtigen.
Auch kann es sein, dass sich ein und dieselbe Krankheit bei einer Frau anders äußert als bei einem Mann. Besondere Bedeutung erfuhr die Gendermedizin im Zusammenhang von Untersuchungen bezüglich Herzerkrankungen. Hier konnte festgestellt werden, dass weibliche Patientinnen oft aufgrund anderer Symptome zu spät oder falsch diagnostiziert wurden. Dass Frauen beispielsweise häufiger an Herzinsuffizienz sterben ist wahrscheinlich auf eine, für Frauen zu hohe, Dosierung der Medikamente zurückzuführen.
Rosa Pille für die Frau, blaue für den Mann?
Genderaspekte sollen in Zukunft auch bei der Erzeugung und Verabreichung von Medikamenten stärker fokussiert werden. Es ist kein Zufall, dass 70% mehr Nebenwirkungen vor allem bei Frauen auftreten. Schuld daran ist die Tatsache, dass Medikamente häufiger an Männern getestet werden. In der Medizin ist der Prototyp Patient seit jeher männlich. Sogar, wenn für die Versuche Tiere hinzugezogen werden, handelt es sich meist um männliche Labortiere. Obwohl Zulassungsbehörden wie die Europäische Arzneimittel-Agentur bereits seit Jahren eine geschlechtergerechtere Prüfung von Medikamenten fordern, erfolgt die Umsetzung durch die Pharmaindustrie nur zögerlich. „Gerade bei den Medikamenten gibt es viele Unterschiede, die in der Forschung stärker beachtet werden müssen. Auch, wenn ich nicht glaube, dass es in Zukunft eine rosa und eine hellblaue Pille geben wird, so soll doch zumindest am Beipacktext stehen, wie das Medikament bei Frauen und wie bei Männern anzuwenden ist. Solche geschlechtsspezifischen Konzepte können zukünftig zur besseren Versorgung beitragen“, meint Kautzky-Willer.
Gendermedizin – Eine Frage des Glaubens?
Bereits vor 15 Jahren gab die Weltgesundheitsorganisation die Empfehlung heraus, im Gesundheitswesen Strategien für eine geschlechtsspezifische Gesundheitsvorsorge zu entwickeln und umzusetzen. Obwohl es in den vergangenen Jahren zwar wesentliche Fortschritte bei der Beachtung des Faktors Geschlecht gab, wird es wohl noch ein langer Weg sein, bis die Gendermedizin in den Arztpraxen ankommt. Für Ärzte, die sich bisher noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, stellt genderspezifische Medizin außerdem einen enormen Mehraufwand dar. „Deswegen ist es wichtig“, rät Kautzky-Willer, „dass eine personalisierte Betreuung von den Patienten nachgefragt und eingefordert wird.“ Dafür brauche es Unterstützung in der Gesellschaft sowie eine bessere Forschungsfinanzierung.
„Die Patienten müssen eine genderspezifische Betreuung einfordern.“
Den Anspruch auf eine geschlechtergerechte Sichtweise bei Therapie und Diagnostik in der medizinischen Behandlung fordern auch die ÖVP Frauen – und das seit mittlerweile mehr als 10 Jahren. „Unser Ziel ist eine flächendeckende gendergerechte medizinische Vorsorge und Versorgung. Daher müsse die Gendermedizin weit mehr als bisher Eingang in die Aus- und Weiterbildung von Ärzten finden“, betont die Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dorothea Schittenhelm. Auf Nachfrage bei dem ehemaligen ÖH-Vorsitzenden der medizinischen Universität Graz, Jakob Mandl heißt es: „Gendermedizin wird in ausgewählten Kapiteln zwar behandelt, gelehrt kann man jedoch nicht sagen. Wir sind weit davon entfernt, dass das wirklich ankommt. Ich denke auch, dass viele Studierende nichts damit anfangen können beziehungsweise einige nicht daran glauben. Einigen ist die Relevanz aber dennoch bewusst und es wird daran gearbeitet hier Defizite in einem zukunftsträchtigen Fach zu beheben"